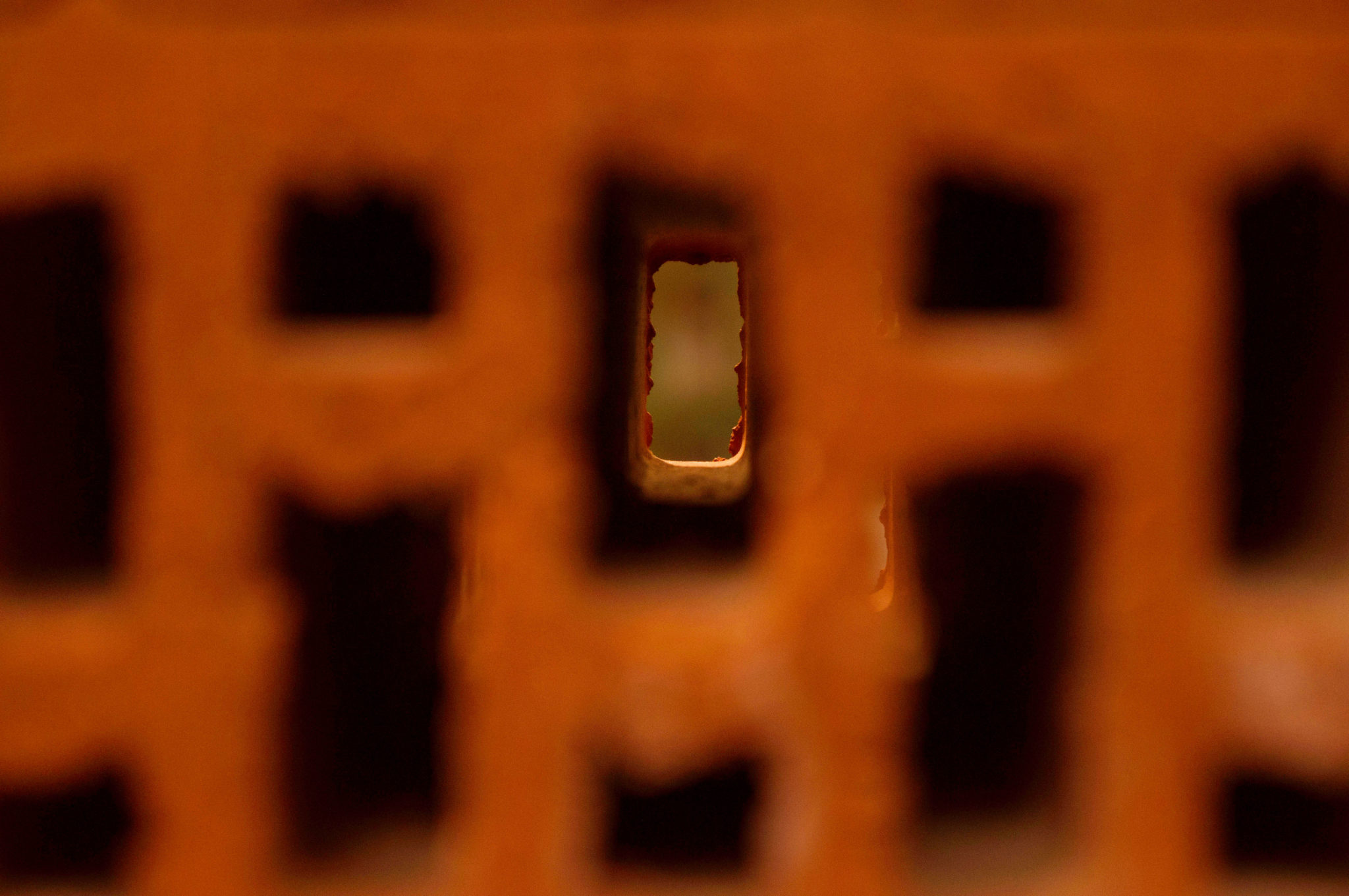Diagnostische Inkompetenz deutscher Lehrkräfte
Viele Lehrkräfte stehen psychologischen Tests einerseits skeptisch bis ablehnend gegenüber und haben andererseits unrealistische und überzogene Erwartungen an sie. Beides hat in der Regel die gleiche Ursache: einen eklatanten Mangel an Wissen über Testdiagnostik.
Psychometrische Verfahren oder psychologische Tests, manchmal auch nur kurz Tests genannt, haben bei deutschen Pädagogen immer noch einen schweren Stand. Die Beziehung vor allem von Lehrkräften zu psychometrischen Verfahren scheint eine ambivalente zu sein. Auf der einen Seite werden die Möglichkeiten und Ergebnisse der Testdiagnostik überschätzt und man erwartet Wunderdinge von ihr. Auf der anderen Seite werden sie völlig abgelehnt, da menschliche Fähigkeiten und Fertigkeiten in ihrer Komplexität und Einzigartigkeit sowieso nicht messbar seien. So stecken viele Praktiker in einem Dilemma: Sie greifen die psychologischen Tests auf und setzen sie ein und lehnen sie gleichzeitig ab, weil sie zwar glauben, sie zu brauchen, aber letztendlich nicht verstehen, worum es sich dabei handelt und wie sie funktionieren.
Drei selbsterlebte Geschichten aus der Praxis verweisen darauf, wie unbedarft manche Pädagogen und Sonderpädagogen mit psychologischen Tests umgehen und wie nützlich und hilfreich differenziertes Wissen über Konstruktion und Funktion psychometrischer Verfahren in der tagtäglichen Praxis sein kann. Dass es sich hierbei leider nicht um ärgerliche Einzelfälle handelt, belegen eine Reihe empirischer Untersuchungen (siehe dazu Breitenbach 2014).
Ein Sonderpädagoge schreibt in seinem Gutachten, der von ihm untersuchte Junge habe einen IQ von 95. Daraufhin antwortet ihm der Psychologe aus der Klinik, dem dieses Gutachten von den Eltern vorgelegt wurde, dass dies doch nicht sein könne und er bitte um eine vollständige und korrekte Ergebnismitteilung. Der Sonderpädagoge regt sich über den Psychologen maßlos auf, ob der vielleicht nicht lesen könne und weiß im Grunde nicht, was der Psychologe von ihm will. Wäre besagtem Sonderpädagogen die Reliabilität oder die Messungenauigkeit eines psychometrischen Verfahrens ein Begriff, hätte er in seinem Gutachten berichtet, dass der IQ des untersuchten Jungen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit in einem bestimmten Bereich, dem so genannten Vertrauensbereich liegt. Der Psychologe hätte dann keinen Grund zur Nachfrage gehabt.
Die Rektorin einer Grundschule fragt bei einem Förderschullehrer, der sie bei der Förderung eines schwierigen Schülers beraten sollte, mit leicht süffisantem Unterton nach, warum ihr Schüler bei der zweiten Intelligenzüberprüfung nun plötzlich einen schlechteren IQ habe als beim ersten Mal. Ist der Schüler vielleicht in den letzten Monaten dümmer geworden? Das könne doch nicht sein und zeige wieder einmal wie unsinnig all diese „Intelligenztesterei“ sei. Der Förderschullehrer gibt der Kollegin aus der Grundschule die einleuchtende Erklärung, dass dies schon einmal vorkommen könne. Leider weiß dieser Förderschullehrer nichts von der Existenz einer kritischen Differenz, die sich ebenfalls aus der Tatsache der Messungenauigkeit psychometrischer Verfahren ergibt. Zwei unterschiedliche Testwerte repräsentieren nur dann auch tatsächlich zwei unterschiedliche Leistungen, wenn ihre rechnerische Differenz größer ist als die kritische. Ist die rechnerische Differenz kleiner, so liegt kein Leistungsunterschied vor, sondern die unterschiedlichen Werte können auf die Reliabilität des verwendeten Testverfahrens zurückgeführt werden. Ein Verweis auf die kritische Differenz und eine entsprechende Erläuterung der beiden unterschiedlichen Testergebnisse hätte der Rektorin aus der Grundschule sonderpädagogische Kompetenz signalisiert und vielleicht ein bisschen zum Abbau eines alten Vorurteils beigetragen.
Ein Vater fragt den Sonderpädagogen, nachdem dieser ihm als Ergebnis einer Intelligenzprüfung mitgeteilt hatte, dass sein Sohn unterdurchschnittlich intelligent sei, wie der Sonderpädagoge denn dazu komme? Das, was bei seinem Sohn mit dem Test untersucht worden sei, habe für ihn nichts mit Intelligenz zu tun, sondern vielmehr mit Bildung und Wissen. Sein Sohn sei zum Beispiel sehr kreativ, phantasievoll und ausdauernd beim Lösen kniffeliger Rätsel. Dies habe den Sonderpädagogen bei der Überprüfung der Intelligenz aber alles überhaupt nicht interessiert. Der Sonderpädagoge weiß auf diese kritische Bemerkung des Vaters nur die wenig kompetente Antwort: Das sei halt bei Intelligenztests so. Der Vater wäre sicher mit mehr Verständnis für seinen Sohn und mit mehr Respekt vor der Fachkompetenz des Sonderpädagogen nach Hause gegangen, hätte dieser dem Vater Recht gegeben und ihm erklärt, dass es die Intelligenz als klar und übereinstimmend definiertes Phänomen nicht gibt, sondern nur verschiedene Modelle, Konzepte und Vorstellungen von Intelligenz. Jedem Intelligenztestverfahren liege nun eine solche spezifische Vorstellung zugrunde und da es bei seinem Sohn um Schulprobleme gehe, habe er deswegen einen Test gewählt, der schulähnliche Leistungen als Intelligenz erfasst.
Offenbar ist der Informationsbedarf groß. Daher werden in den nächsten Wochen die theoretischen Grundlagen und zentrale Begriffe der Testdiagnostik erläutert werden.
Folgende Themen erwarten Sie:
- Vorteile und Nachteile psychometrischer Verfahren
- Klassische und probabilistische Testtheorie
- Testkonstruktion nach der Klassischen Testtheorie (KTT)
- Qualitätsprüfung durch Gütekriterien
- Normen und Prozentränge
- Vertrauensintervall und kritische Differenz
Sie finden alle Artikel hierzu unter dem Schlagwort „Testdiagnostik“.
Hier geht es zu Teil 2 der Reihe.
- Psychologische Diagnostik (Lehrbuch mit Online-Materialien) (Springer-Lehrbuch)
- Psychologie in der Heil- und Sonderpädagogik (Nachbarwissenschaften Der Heil- Und Sonderpadagogik)
- Lehrbuch der psychologischen Diagnostik: Mit Hinweisen zur Intervention
- Diagnostik für Lehrkräfte
- Psychologische Diagnostik: Grundlagen und Anwendungsperspektiven (Urban-Taschenbucher)